 |
 |
 |
| |
Jazzzeitung
2009/02 ::: seite 15
rezensionen
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Johnny Griffin
Night Lady
Emarcy 06025 1794191
 „Oh, Night Lady!“ rief Johnny Griffin aus, als ich Jüngling
einst von allen Möglichen ausgerechnet diese rare Platte aus dem
Jahr 1964 zum Signieren hinhielt. Dieses „Oh!“ hinterfragte
ich freilich nicht, aber es meinte wohl so etwas wie, „da ist mir
vor 20 Jahren ein ganz feines Album geglückt“. Jetzt ist es
für einen Apfel und ein Ei zu erstehen in einer CD-Ausgabe der Universal-Serie „Jazzclub“,
in der bislang nur Compilations herausgebracht wurden, ab sofort aber
auch einige etwas vergessene Originals. Kaum bekannt, gilt „Night
Lady“ sicherlich nicht als grundlegendes Griffin-Album, bekommt
es doch in all den Nachschlagewerken von Leuten, die es wohl nie gehört
haben, nur verlegene drei von fünf möglichen Sternen. Mein
Gott, es ist schlicht vollkommen! Es verbindet die sorgfältige Planung
eines Studioalbums mit der Lockerheit eines Live-Auftritts in der Runde
von Kollegen, mit denen nichts schief gehen kann. Der Pianist Francy
Boland, der Bassist Jimmy Woode, der Drummer Kenny Clarke bildeten die
Rhythmusgruppe, mit der Griffin noch in der unvergessenen Kenny Clarke-Francy
Boland Big Band musizieren sollte. Der Routine verfallen sie nie; sie
spontane Lust am kreativen Ausprobieren herrscht vor. Die vom Tenoristen
in vielen Schattierungen entfaltete Pracht seines Tenorsounds kommt gut
zur Geltung in einem Programm, das viele selten gespielte Stücke
enthält. Allein schon Bolands bluesiger Walzer „Night Lady“ macht
das Album fast zum Klassiker. „Oh, Night Lady!“ rief Johnny Griffin aus, als ich Jüngling
einst von allen Möglichen ausgerechnet diese rare Platte aus dem
Jahr 1964 zum Signieren hinhielt. Dieses „Oh!“ hinterfragte
ich freilich nicht, aber es meinte wohl so etwas wie, „da ist mir
vor 20 Jahren ein ganz feines Album geglückt“. Jetzt ist es
für einen Apfel und ein Ei zu erstehen in einer CD-Ausgabe der Universal-Serie „Jazzclub“,
in der bislang nur Compilations herausgebracht wurden, ab sofort aber
auch einige etwas vergessene Originals. Kaum bekannt, gilt „Night
Lady“ sicherlich nicht als grundlegendes Griffin-Album, bekommt
es doch in all den Nachschlagewerken von Leuten, die es wohl nie gehört
haben, nur verlegene drei von fünf möglichen Sternen. Mein
Gott, es ist schlicht vollkommen! Es verbindet die sorgfältige Planung
eines Studioalbums mit der Lockerheit eines Live-Auftritts in der Runde
von Kollegen, mit denen nichts schief gehen kann. Der Pianist Francy
Boland, der Bassist Jimmy Woode, der Drummer Kenny Clarke bildeten die
Rhythmusgruppe, mit der Griffin noch in der unvergessenen Kenny Clarke-Francy
Boland Big Band musizieren sollte. Der Routine verfallen sie nie; sie
spontane Lust am kreativen Ausprobieren herrscht vor. Die vom Tenoristen
in vielen Schattierungen entfaltete Pracht seines Tenorsounds kommt gut
zur Geltung in einem Programm, das viele selten gespielte Stücke
enthält. Allein schon Bolands bluesiger Walzer „Night Lady“ macht
das Album fast zum Klassiker.
Wild Bill Davison
In Copenhagen
Storyville 101 8523
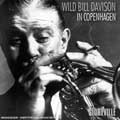 Storyville, das 1952 gegründete Label (das nach dem 1917 geschlossenen
Sperrbezirk von New Orleans benannt ist, in das die Legende fälschlich
die Geburt des Jazz verlegt), ist heute noch sehr rührig. In den
letzten Monaten bringt es unter dem Titel „In Copenhagen“ eine
Reihe historischer Schätze auf den Markt, Live-Mitschnitte so unterschiedlicher
Musiker wie Teddy Wilson, Bud Powell, Frank Rosolino oder Jay McShann.
Das wenigste davon ist neu, auch vorliegendes Beispiel war schon als
LP und als CD erschienen, doch alles ist hörenswert und rückt
als Serie betrachtet, mehr noch als die Einzelleistungen der Bandleader,
die Bedeutung der Stadt als Jazzmetropole von internationalem Rang ins
Blickfeld. Wo sich Größen wie Oscar Pettiford oder Dexter
Gordon niederlassen, wo ein Jazzlokal wie das Montmartre steht und erstklassige
einheimische Musiker zur Stelle sind, da mussten sich auch gastierende
Größen wohlfühlen. Das gilt auch für den Kornettisten
Bill Davison, der noch 69-jährig mit einer unheimlichen Ausdruckskraft
gesegnet war, als er mit Dänen wie etwa den Saxophonisten Jesper
Thilo und Uffe Karskov diese Aufnahmen machte. Der Heißsporn konnte
Balladen und Blues so spielen, dass einem die Tränen in die Augen
schießen, ganz nach seinem Ideal „so singend wie Bix, so
kraftvoll wie Louis”, doch mit seinem eigenen raubeinigen Charme.
Weil er selbst so bewegt klingt, vermag er in Songs wie „I Can’t
Get Started“ tief zu bewegen. Storyville, das 1952 gegründete Label (das nach dem 1917 geschlossenen
Sperrbezirk von New Orleans benannt ist, in das die Legende fälschlich
die Geburt des Jazz verlegt), ist heute noch sehr rührig. In den
letzten Monaten bringt es unter dem Titel „In Copenhagen“ eine
Reihe historischer Schätze auf den Markt, Live-Mitschnitte so unterschiedlicher
Musiker wie Teddy Wilson, Bud Powell, Frank Rosolino oder Jay McShann.
Das wenigste davon ist neu, auch vorliegendes Beispiel war schon als
LP und als CD erschienen, doch alles ist hörenswert und rückt
als Serie betrachtet, mehr noch als die Einzelleistungen der Bandleader,
die Bedeutung der Stadt als Jazzmetropole von internationalem Rang ins
Blickfeld. Wo sich Größen wie Oscar Pettiford oder Dexter
Gordon niederlassen, wo ein Jazzlokal wie das Montmartre steht und erstklassige
einheimische Musiker zur Stelle sind, da mussten sich auch gastierende
Größen wohlfühlen. Das gilt auch für den Kornettisten
Bill Davison, der noch 69-jährig mit einer unheimlichen Ausdruckskraft
gesegnet war, als er mit Dänen wie etwa den Saxophonisten Jesper
Thilo und Uffe Karskov diese Aufnahmen machte. Der Heißsporn konnte
Balladen und Blues so spielen, dass einem die Tränen in die Augen
schießen, ganz nach seinem Ideal „so singend wie Bix, so
kraftvoll wie Louis”, doch mit seinem eigenen raubeinigen Charme.
Weil er selbst so bewegt klingt, vermag er in Songs wie „I Can’t
Get Started“ tief zu bewegen.
Johnny Hodges
My Main Man
Le Chant Du Monde 274 1601.02
 Jazz-Einsteiger, die das Schaffen bedeutender Jazzmusiker mit dem Kauf
einer platzsparend verpackten Doppel-CD abdecken wollen, tun mit Alben
der Reihe „Jazz Characters“ einen guten Griff. André Francis
und Jean Schwarz wählen mit sicherem Griff aus der Fülle das
Typische, liefern die notwendigen diskographischen Daten mit (bei heutigen
Serien leider keine Selbstverständlichkeit mehr) und schreiben eine
Einführung, die allerdings nicht länger ist als ein knapper
Lexikoneintrag. Aus rechtlichen Gründen sind keine Aufnahmen dabei,
die jünger als 50 Jahre sind, doch ein Anfang ist damit getan. Wer
so kompetent eingeführt wird, erkennt zweifellos, ob der vorgestellte
Musiker einem weitere Nachforschungen wert ist. 50 solcher Alben sind
bereits erschienen. Eines der letzten widmet sich dem Alt- und Sopran-Saxophonisten
Johnny Hodges (1906–1970), der in Aufnahmen der Jahre 1928 bis
1958 chronologisch vorgestellt wird. Der neben Benny Carter bedeutendste
Altist des Swing verbrachte fast sein ganzes Leben bei Duke Ellington.
Mit seinem berückenden Sound und seinen virtuos gehandhabten Ausdrucksmitteln
wie etwa langsam gleitenden Glissandi (schön zu hören in „Passion
Flower“), war „Rabbit” der meistgefeaturte Solist des
Duke, machte aber auch bedeutende Aufnahmen unter eigener Regie, jedoch
meist mit Ellington-Leuten (z.B. „Jeeps Blues“). Warum gerade
sein großer R&B-Hit „Castle Rock“ fehlt? So ist
das nun einmal auch bei guten Zusammenstellungen. Jazz-Einsteiger, die das Schaffen bedeutender Jazzmusiker mit dem Kauf
einer platzsparend verpackten Doppel-CD abdecken wollen, tun mit Alben
der Reihe „Jazz Characters“ einen guten Griff. André Francis
und Jean Schwarz wählen mit sicherem Griff aus der Fülle das
Typische, liefern die notwendigen diskographischen Daten mit (bei heutigen
Serien leider keine Selbstverständlichkeit mehr) und schreiben eine
Einführung, die allerdings nicht länger ist als ein knapper
Lexikoneintrag. Aus rechtlichen Gründen sind keine Aufnahmen dabei,
die jünger als 50 Jahre sind, doch ein Anfang ist damit getan. Wer
so kompetent eingeführt wird, erkennt zweifellos, ob der vorgestellte
Musiker einem weitere Nachforschungen wert ist. 50 solcher Alben sind
bereits erschienen. Eines der letzten widmet sich dem Alt- und Sopran-Saxophonisten
Johnny Hodges (1906–1970), der in Aufnahmen der Jahre 1928 bis
1958 chronologisch vorgestellt wird. Der neben Benny Carter bedeutendste
Altist des Swing verbrachte fast sein ganzes Leben bei Duke Ellington.
Mit seinem berückenden Sound und seinen virtuos gehandhabten Ausdrucksmitteln
wie etwa langsam gleitenden Glissandi (schön zu hören in „Passion
Flower“), war „Rabbit” der meistgefeaturte Solist des
Duke, machte aber auch bedeutende Aufnahmen unter eigener Regie, jedoch
meist mit Ellington-Leuten (z.B. „Jeeps Blues“). Warum gerade
sein großer R&B-Hit „Castle Rock“ fehlt? So ist
das nun einmal auch bei guten Zusammenstellungen.
Paul Chambers
Quintet
Blue Note 50999 2 65144 2 0
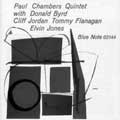 Liest man heute die Namen des Bassisten Paul Chambers, des Trompeters
Donald Byrd, des Tenoristen Clifford Jordan, des Pianisten Tommy Flanagan
und des Drummers Elvin Jones, zieht man sehr tief seinen Hut, so man
einen auf hat. Man weiß, was für Könner da versammelt
sind. Als aber dieses Album am 19. Mai 1957 entstand, wussten nur eingeschworene
Jazzfreunde, die ihr Ohr am Puls der Zeit hatten, was für Riesentalente
von des Jazz legendärstem Tonmeister Rudy Van Gelder aufgenommen
wurden. Bandleader Chambers war mit seinen 22 Lenzen ja schon fast berühmt,
da gerade Bassist bei Miles Davis. Zwei Stücke aus Benny Golsons
goldener Feder sind ihm hier zugedacht, die wohl nie wieder gespielt
wurden und hörenswert sind. Tommy Flanagan machte erst seit einem
Jahr Aufnahmen, allerdings viele, oft im Team mit Chambers und war schon
die Souveränität in Person, hier der reifste Solist. Donald
Byrd galt erst seit zwei Jahren als vielversprechener Nachwuchs im Clifford-Brown-Stil
und war an jenem Tag nicht ganz so sicher wie sonst. Elvin Jones wurde
erst einige Jahre später berühmt und swingt mit leiser Federleichtigkeit.
Für Clifford Jordan war es erst die zweite Aufnahmesitzung, man
hört Unsicherheiten, die im nächsten Augenblick verfliegen,
weil er sich mit solcher Begeisterung und Musikalität einbringt.
Dieses Album besticht also nicht durch Perfektion, und doch geht von
ihm ein besonderer Reiz aus: Blühende Jugend im Aufwind! Liest man heute die Namen des Bassisten Paul Chambers, des Trompeters
Donald Byrd, des Tenoristen Clifford Jordan, des Pianisten Tommy Flanagan
und des Drummers Elvin Jones, zieht man sehr tief seinen Hut, so man
einen auf hat. Man weiß, was für Könner da versammelt
sind. Als aber dieses Album am 19. Mai 1957 entstand, wussten nur eingeschworene
Jazzfreunde, die ihr Ohr am Puls der Zeit hatten, was für Riesentalente
von des Jazz legendärstem Tonmeister Rudy Van Gelder aufgenommen
wurden. Bandleader Chambers war mit seinen 22 Lenzen ja schon fast berühmt,
da gerade Bassist bei Miles Davis. Zwei Stücke aus Benny Golsons
goldener Feder sind ihm hier zugedacht, die wohl nie wieder gespielt
wurden und hörenswert sind. Tommy Flanagan machte erst seit einem
Jahr Aufnahmen, allerdings viele, oft im Team mit Chambers und war schon
die Souveränität in Person, hier der reifste Solist. Donald
Byrd galt erst seit zwei Jahren als vielversprechener Nachwuchs im Clifford-Brown-Stil
und war an jenem Tag nicht ganz so sicher wie sonst. Elvin Jones wurde
erst einige Jahre später berühmt und swingt mit leiser Federleichtigkeit.
Für Clifford Jordan war es erst die zweite Aufnahmesitzung, man
hört Unsicherheiten, die im nächsten Augenblick verfliegen,
weil er sich mit solcher Begeisterung und Musikalität einbringt.
Dieses Album besticht also nicht durch Perfektion, und doch geht von
ihm ein besonderer Reiz aus: Blühende Jugend im Aufwind!
Horace Silver
Tokyo Blues
Blue Note 50999 2 65146 2 8
 Sieht man einmal von Songs wie „Japanese Sandman“ ab, die
mit japanischer Kultur nichts zu tun haben, war Japan lange im Jazz kein
Thema, wohl aber Jazz in Japan. In den frühen 60ern kommt es plötzlich
zu einer Häufung japanischer Thematik. Vor allem im schwarzen Hardbop
und Soul Jazz deuten Titel und/oder Melodik eine entdeckte Vorliebe für
das vielbetourte Land an, deren Menschen Jazz so lieben. Immer wieder
sind es Pianisten, die hierin beispielhaft waren. Cedar Walton legt als
Komponist und Pianist auf Blakeys Alben „Ugetsu“ (1963) und „Kyoto“ (1964)
vor, der 2008 verstorbene Ronnie Mathews komponierte „Ichi-Ban“ (1963)
und der von einer ganz anderen „Baustelle“ kommende Dave
Brubeck lieferte „Jazz Impressions Of Japan“ (1964). Der
modale Jazz à la Coltrane und Davis hatte ein Bewußtsein
für „exotische“ Skalen geschaffen, das auch auf Musiker
abfärbte, deren Musik „down home“ blieb. Horace Silver
hat mit „Tokyo Blues“ 1962 das idealtypische Album dieses
Genres geschaffen, das man nach einem Plattentitel von Cannonball Adderley „Nippon
Soul“ (1963) taufen könnte. Auffallend ist die Abwesenheit
oberflächlicher Orientalismen, aber auch folkloristischer Studien.
Vielmehr führt japanoide Motivik und ihre Kombination mit lateinamerikanischen
Rhythmen zu Stücken, die einfach typisch „silverisch“ sind.
Seinem mitreißenden Quintett gehörten Blue Mitchell (tp),
Junior Cook (ts), Gene Taylor (b) und John Harris (d) als Ersatz für
Roy Brooks an. Sieht man einmal von Songs wie „Japanese Sandman“ ab, die
mit japanischer Kultur nichts zu tun haben, war Japan lange im Jazz kein
Thema, wohl aber Jazz in Japan. In den frühen 60ern kommt es plötzlich
zu einer Häufung japanischer Thematik. Vor allem im schwarzen Hardbop
und Soul Jazz deuten Titel und/oder Melodik eine entdeckte Vorliebe für
das vielbetourte Land an, deren Menschen Jazz so lieben. Immer wieder
sind es Pianisten, die hierin beispielhaft waren. Cedar Walton legt als
Komponist und Pianist auf Blakeys Alben „Ugetsu“ (1963) und „Kyoto“ (1964)
vor, der 2008 verstorbene Ronnie Mathews komponierte „Ichi-Ban“ (1963)
und der von einer ganz anderen „Baustelle“ kommende Dave
Brubeck lieferte „Jazz Impressions Of Japan“ (1964). Der
modale Jazz à la Coltrane und Davis hatte ein Bewußtsein
für „exotische“ Skalen geschaffen, das auch auf Musiker
abfärbte, deren Musik „down home“ blieb. Horace Silver
hat mit „Tokyo Blues“ 1962 das idealtypische Album dieses
Genres geschaffen, das man nach einem Plattentitel von Cannonball Adderley „Nippon
Soul“ (1963) taufen könnte. Auffallend ist die Abwesenheit
oberflächlicher Orientalismen, aber auch folkloristischer Studien.
Vielmehr führt japanoide Motivik und ihre Kombination mit lateinamerikanischen
Rhythmen zu Stücken, die einfach typisch „silverisch“ sind.
Seinem mitreißenden Quintett gehörten Blue Mitchell (tp),
Junior Cook (ts), Gene Taylor (b) und John Harris (d) als Ersatz für
Roy Brooks an.
Alle Rezensionen: Marcus A. Woelfle
|

